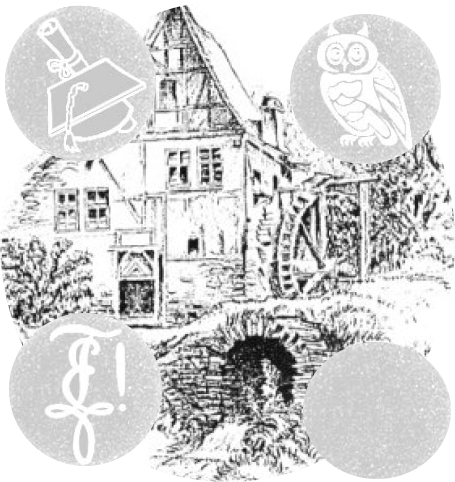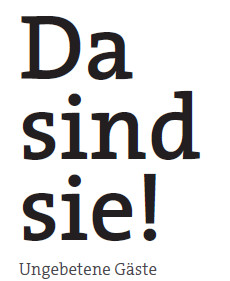von Ketscha
von Ketscha
Meine Kindheit in dem lippischen Dorf Alverdissen liegt mehr als 60 Jahre zurück. Wenn ich sie mit dem Leben heutiger Kinder vergleiche, erkenne ich, daß fast alles anders geworden ist. Wir brachten unsere Nachmittage in den Wäldern und Feldern zu, auch auf den riesigen Heu- und Strohböden, wo wir unsere Buden und Höhlensysteme hatten, von denen die Bauern meist nichts ahnten. Auf der Hauptstraße konnten wir stundenlang Völker- oder Treibball spielen, ganz ungestört, denn in dem 1ooo-Seelen-Dorf Alverdissen gab es nur ein Auto, holzgasgetrieben. Als Acht- oder Neunjähriger lernte ich zu trampen: mittags ließ ich mich von Bauernwagen (schöner noch im Winter mit den Pferdeschlitten), die zur Eimker Mühle fuhren, mitnehmen und kam auf diese Weise durchs Extertal wohl bis Rinteln und mußte dann zusehen, wie ich vor dem Dunkelwerden heimkam. Einmal nahm mich auch der Großvater in aller Herrgottsfrühe (wohl um 3 Uhr) auf dem Einspänner mit, hinter uns rumpelten zwei große Milchkannen. So fuhren wir über 30 km in den kühlen Sommermorgen. In Hameln tauschten wir die beiden Kannen gegen zwei einjährige Pferde ein. Erst viel später erfuhr ich, daß die Kannen selbstgebrannten Schnaps enthalten hatten …
„Bündisch“ wurde ich mit neun Jahren, als ich zum CVJM kam. Bündisch? Ja, der CVJM war in mancher Hinsicht zünftiger als viele Bünde heute. Neben christlichem Liedgut lernte ich auch viele Lieder aus der Jugendbewegung. Als Elfjähriger nahm ich an einem CVJM-Zeltlager bei den Wilden Teichen mitten im Reinhardswald teil, zu dessen Ende es ein zweitägiges großräumiges Geländespiel gab.
Zu Anfang der 50er Jahre nahmen die Kirchen ihre Jugendgruppen an kürzere Zügel. Die jugendbewegten Elemente traten zurück hinter jugendpflegerischen Bemühungen. Ich wollte mich nicht pflegen lassen und trat aus.
Inzwischen wohnten wir wieder in der Stadt, in Bad Salzuflen. Da ich mir ein Leben ohne Gruppe nicht vorstellen konnte, begann ich zu suchen. Ich hatte von meinem Vater und seinen neun Geschwistern, die alle in den 20er Jahren jugendbewegt gewesen waren, immer wieder vom Wandervogel gehört, von Lagern und Fahrten und Gemeinschaft. Ich fragte also meinen Vater, ob es solche Bünde nicht wieder gebe. Er schickte mich nach Herford, gleich nebenan, und dort gab es ein Halbdutzend bündischer Gruppen. Nach einjährigem Zwischenspiel als Zwölfjähriger in der Deutschen Freischar keilte mich Mampi für den Wandervogel, Deutscher Bund. Zwölf Jahre lang hat dieser Bund mein Leben stärker erfüllt und geprägt als alles andere. Die Schule habe ich darüber vernachlässigt, auch die Familie – ich gebe es zu – trat hinter dem WV zurück. Für Freunde außerhalb des Bundes war wenig Zeit. Aber ich bereue das bis heute alles nicht. Denn nichts hat mich tiefer geprägt als der Wandervogel. Ich kann es mir nicht vorstellen, was und wie ich geworden wäre ohne ihn. Lacht ruhig: noch heute, 50 Jahre danach, kreisen meine Träume oft um Fahrt und Lager und die alten Kameraden.

Wir waren keine Gruppe, die sich einmal in der Woche zur Heimrunde traf (die gab es auch) und zuweilen auf Fahrt ging. Wir lebten sieben Tage in der Woche miteinander.
Mampi, unser Hortenführer, war Maurer (so etwas gab es selten in unserem Bund, der fast nur aus Pennälern und Studenten bestand). Ein Privatleben gestatteten wir ihm kaum. Wenn er von der Arbeit kam, saßen meist schon einige von uns in seiner Bude. Der eine brachte ein neues Lied mit, der andere einen neuen Tee, ein dritter hatte einen Lyriker entdeckt, von dem er aufgeregt ein paar Gedichte vorlas; auch Schallplatten wurden angeschleppt oder Dramen mit verteilten Rollen gelesen. Bei klarem Himmel gingen wir abends auf den Langenberg und lernten die Sternbilder kennen. Jeder trug das bei, was ihn gerade bewegte. Eine gewisse Kontinuität stellten nur die Lieder und die Prügeleien her. Wenn es uns interessierte, besuchten wir politische Versammlungen (z.B. ging es damals um die Wiederbewaffnung, und da wir in dieser Hinsicht äußerst verschiedene Auffassungen hatten, hörten wir Vertretern aller Richtungen zu und diskutierten dann in der Horte leidenschaftlich darüber). Daß wir Theateraufführungen und Konzerte gemeinsam (und zwar in Kluft) besuchten, versteht sich.
Mädchen gab es übrigens auch, sowohl im Ortsring Herford als auch im Bund allgemein.
Aber wir Jüngeren hatten lange so gut wie nichts miteinander zu tun. Nur das Bundeslager und die Jahresschlußwochen wurden gemeinsam veranstaltet. Erst im Studentenalter trafen wir uns häufiger mit den Mädchen: zu Spielfahrten etwa und zum Volkstanz und Chorsingen. Die Trennung der Mädchen- und Jungenarbeit hatte vor allem zwei Gründe:
a) die Unvereinbarkeit unseres stramm jungenschaftlichen Stils mit der Art der Mädchen (unter denen es freilich, von uns mißtrauisch beäugt, auch solche gab, die gern jungenschaftlicher als Jungen auftraten);
b) die – gewiß berechtigte – Befürchtung, daß die Pärchenbildung in gemischten Gruppen den inneren Zusammenhalt zerstören würde.
So entwickelten Jungen- und Mädchengruppen getrennt ihren eigenen Stil und ihre eigenen Formen. Natürlich gab es unter den Älteren Zweierbeziehungen, aber im Bund lebte man die nicht aus, um die große Gemeinschaft nicht zu stören oder gar durch Zweierinseln zu gefährden. Im Winterlager 1964/65 sah ich zum ersten Mal zwei Leutchen Hand in Hand spazieren. Das war aber auch die Zeit, als der WV unter vor-68-er Einfluß sein Wesen rasch zu verändern begann. Damals brach auch die politische Offenheit im Bund unter der Prägung durch mehrere dem SDS angehörende oder nahe stehende Bundesführer zusammen.
 Wie offen die Gruppen und der Bund in den frühen Jahren politisch waren, kann man sich heute, im Zeitalter der „political correctness“, wohl kaum vorstellen. Mampi war natürlich Sozialdemokrat, ich war national. Und zwischen diesen beiden Polen bewegten sich die politischen Gesinnungen in der Horte. Keiner wäre – damals – auch nur im Entferntesten auf den Gedanken gekommen, eine dieser Meinungen für unvereinbar mit dem WV zu erklären. Die Freundschaft, die Gemeinschaft waren viel stärker als alle weltanschaulichen Gegensätze. Bei aller politischen Verschiedenartigkeit gab es – in der Gruppe wie im Bund – eine selbstverständliche gemeinsame Grundlage: das Bekenntnis zur deutschen Nation und ihrer Geschichte. Von „Menne“, der wenig später Juso wurde, lernte ich das Lied „Nichts kann uns rauben“, „Figaro“ lehrte uns „Wenn alle untreu werden“. Über fast allen Gruppenwimpeln des Bundes flatterte das Baltenkreuz als Zeichen der Verbundenheit mit den Ostgebieten. Und unser Bundesführer Ekkehard Krippendorf, später ein großer APO-Führer und danach ein Spät-68-er Professor in Berlin, schrieb im Bundesblatt 6/1 : „Und das ist das Wesentliche, was wir von diesem Feuer vom Herzberg mit nach Hause nehmen: Wir wissen um unsere Pflichten, um unsere Verantwortung, daß der Bund bleibe – für das Reich.“
Wie offen die Gruppen und der Bund in den frühen Jahren politisch waren, kann man sich heute, im Zeitalter der „political correctness“, wohl kaum vorstellen. Mampi war natürlich Sozialdemokrat, ich war national. Und zwischen diesen beiden Polen bewegten sich die politischen Gesinnungen in der Horte. Keiner wäre – damals – auch nur im Entferntesten auf den Gedanken gekommen, eine dieser Meinungen für unvereinbar mit dem WV zu erklären. Die Freundschaft, die Gemeinschaft waren viel stärker als alle weltanschaulichen Gegensätze. Bei aller politischen Verschiedenartigkeit gab es – in der Gruppe wie im Bund – eine selbstverständliche gemeinsame Grundlage: das Bekenntnis zur deutschen Nation und ihrer Geschichte. Von „Menne“, der wenig später Juso wurde, lernte ich das Lied „Nichts kann uns rauben“, „Figaro“ lehrte uns „Wenn alle untreu werden“. Über fast allen Gruppenwimpeln des Bundes flatterte das Baltenkreuz als Zeichen der Verbundenheit mit den Ostgebieten. Und unser Bundesführer Ekkehard Krippendorf, später ein großer APO-Führer und danach ein Spät-68-er Professor in Berlin, schrieb im Bundesblatt 6/1 : „Und das ist das Wesentliche, was wir von diesem Feuer vom Herzberg mit nach Hause nehmen: Wir wissen um unsere Pflichten, um unsere Verantwortung, daß der Bund bleibe – für das Reich.“
Wenn man mich heute fragt, was denn den Wandervogel von nichtbündischen Jugendgruppen unterschied, so sind es wohl vor allem drei Dinge: die Offenheit, das Musische und die Fahrt als Lebensform.
Die Offenheit unterschied uns von den meisten anderen Jugendorganisationen, auch bündischen. Bei uns gab es Leute aller politischen Schattierungen, von rechts bis links; es gab viele Protestanten, viele Heiden, aber auch einige Katholiken.
Über Zu- oder Abneigung aber entschied der Mensch, der hinter den Überzeugungen stand.
Das Musische war bei uns, denke ich, ausgeprägter als in allen oder fast allen anderen Bünden. Aber auch da gab es sehr unterschiedliche Phasen. 1952/52, als ich WV wurde, setzte sich gerade der jungenschaftliche Stil durch: wir kauften die ersten Jujas und verdienten uns durch ein Waldeinsatzlager Ostern ’53 die erste Kothe (bis dahin gingen wir mit Dreieckszeltbahnen der Wehrmacht auf Fahrt). Aber wir sangen auch jungenschaftlich, und das bedeutete: sehr zackig, aber meist wenig musikalisch, übrigens oft sehr militärisch.
Ein Beispiel:
„Trommeln und Fanfaren,
lauter wilder Schrei,
hundert Jungen rennen
vorbei.
Über ihnen weht
Wie eine Flamme: die Fahne. …“
Oder das Lied von der silberglänzenden Trompete:
„ … hast mich zur Armee gerufen,
rufst am Abend, rufst am Morgen:
Seid Soldaten!“
Dazu paßte es, daß wir meist ohne Klampfe, nur mit einer Landsknechtstrommel sangen.
Deutsche Volkslieder wurden damals fast gar nicht mehr gesungen. Die waren nicht zackig, außerdem kannte sie jeder (das war damals bei vielen Liedern wirklich so), und wir wollten nur Besonderes singen. Ein sanfterer, musischerer Stil kam später durch ausländische Volkslieder auf, die wir von Großfahrt mitbrachten oder aus dem TURM 1 lernten. Erst 1961 ersangen der Heiner und ich uns als Tübinger Studenten den ganzen „Zupf“, und sehr schnell breitete sich dieses alte WV-Liederbuch wieder im Bund aus und verdrängte mit anderem bündischen Liedgut den harten jungenschaftlichen Stil.
Was einer war, was einer taugte, zeigte aber am klarsten und eindeutigsten die Fahrt. Auf sie lebten wir hin, sie war das Ziel unserer Träume. Keiner meiner Pimpfe wäre auf den Gedanken gekommen, mit den Eltern nach Marokko oder Griechenland zu reisen, wenn er mit der Horte durch den Odenwald oder das Weserbergland ziehen konnte. Die Nächte in der Kothe oder unter freiem Himmel, die Strapazen der Märsche, die Unwettertage in der Spessartscheune, die Fahrten mit den Flößern auf der Weser, am meisten aber die Wildfahrten im Herbst (nur zwei oder drei Leute; nur mit Poncho, Messer, Kochgeschirr, Löffel und Streichhölzern ausgerüstet) – das schweißte uns zusammen und zeigte in wenigen Tagen, oft nach Stunden, wer zu uns paßte und gehörte.
Es gibt ein wunderschönes Lied Werner Helwigs, dessen Kehrreim lautet:
„Nun macht das Leben groß,
heijo, die Fahrt geht los.“
Darum ging es uns: um großes Leben, um Härte, Entbehrung, Selbstüberwindung, Tapferkeit. Um die Verachtung des Bequemen, des Spießbürgerlichen, des Alltäglichen, des Gemeinen. Zugegeben: dabei half uns eine gewisse bündische Arroganz. Wir waren uns sicher, nicht nur anders, sondern besser zu sein als die anderen. Aber diese Arroganz machte es uns auch leichter, höchsten Anforderungen standzuhalten, das Äußerste von uns selbst zu verlangen. Lange hing in unserem Heim, von Dieter gemalt, ein japanischer Zen-Spruch, den wir als uns gemäß empfanden:
„Wie ihr den Bogen spannt,
so spannt auch eure Seelen,
besorgt, daß nicht der Pfeil
zu kurz geschnitten werde.“
Dieses intensive, gespannte Leben ist nicht spurlos verweht. Wir sind alle mit Anstand erwachsen geworden. Aber unser Ortsring Herford der 50-er und frühen 60-er Jahre lebt weiter. Die „Herforder Mädchen“ (heute Mittsechzigerinnen) reisen gemeinsam. Unsere Jungenhorte von damals hält zusammen, und die alten Kameraden sind fast alle miteinander in Verbindung geblieben. Wir besuchen einander, schreiben uns, verreisen zusammen, treffen uns hier und dort. Die Träume unserer Jugend sind nicht verweht, sie verbinden uns bis heute, so unterschiedlich unsere Schicksale, unsere Weltanschauungen, unsere persönlichen Verhältnisse sein mögen.
Hans Blüher, der Philosoph und Pädagoge aus dem Alt-Wandervogel, beschrieb in seiner Autobiographie „Werke und Tage“ seine erste Heimrunde im Steglitzer Wandervogel bei Karl Fischer. Dieser Bericht endet mit den Worten: „An diesem Tag begann das Glück meiner Jugend.“ Dem will ich nichts hinzufügen.


 Infolge der sogenannten Corona-Krise gab es viel Stillstand aber ebenso viel Bewegung. Aus diesen Bewegungsimpuls ist eine neue Gemeinschaft erwachsen, die sich in Anlehnung an das Virus Corona (lat. Für Krone oder Kranz) „Tatenbund Krone“ nennt. Im Gründungsaufruf heißt es u.a.:
Infolge der sogenannten Corona-Krise gab es viel Stillstand aber ebenso viel Bewegung. Aus diesen Bewegungsimpuls ist eine neue Gemeinschaft erwachsen, die sich in Anlehnung an das Virus Corona (lat. Für Krone oder Kranz) „Tatenbund Krone“ nennt. Im Gründungsaufruf heißt es u.a.: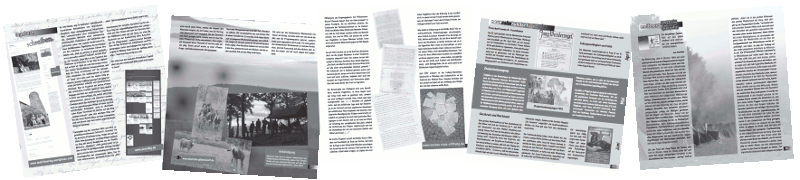
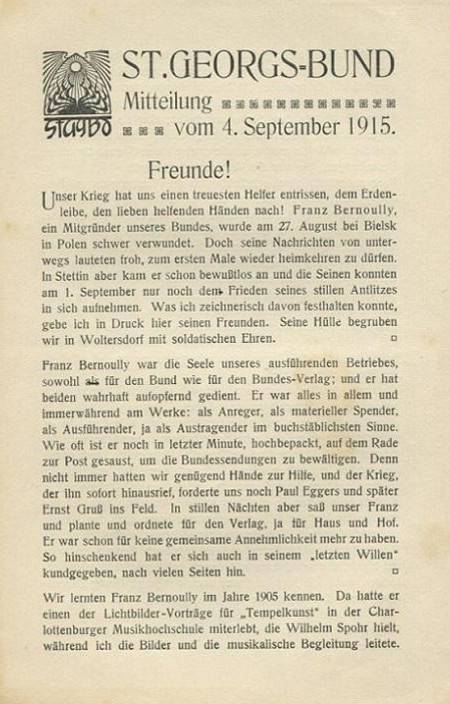
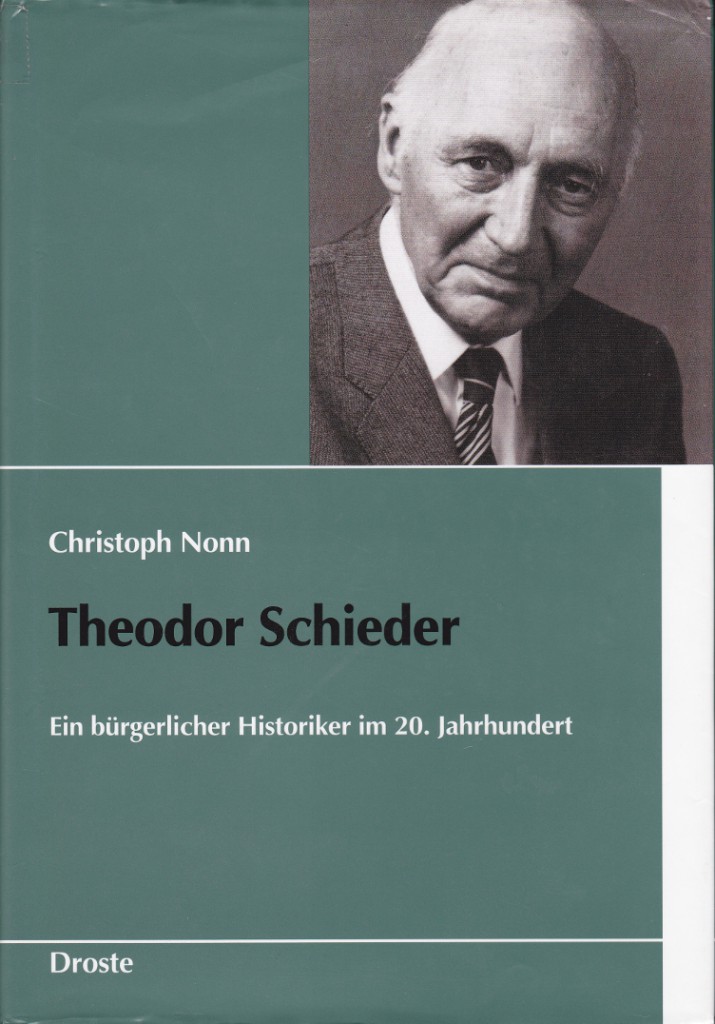
 Den Anfängen der Lebensreform in der Mark Brandenburg widmet
Den Anfängen der Lebensreform in der Mark Brandenburg widmet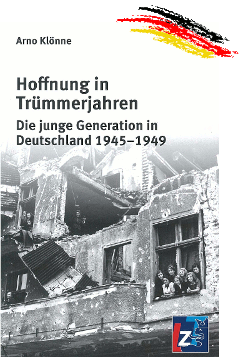 Es ist einige Monate her, da erhielten wir Post von Arno Klönne. Statt eines längeren Kommentars oder einer umfangreichen Ergänzung eines Artikels schickte er uns kommentarlos den Hinweis auf sein neues Heftchen, welches dieses Jahr in der Schriftenreihe der Landeszentrale für politische Bildung (LfpB) Thüringen erschien. Seine Nachricht blieb bis zu seinem Tod unbeantwortet. Nun haben wir das Heft bestellt, gelesen und stellen es hiermit vor.
Es ist einige Monate her, da erhielten wir Post von Arno Klönne. Statt eines längeren Kommentars oder einer umfangreichen Ergänzung eines Artikels schickte er uns kommentarlos den Hinweis auf sein neues Heftchen, welches dieses Jahr in der Schriftenreihe der Landeszentrale für politische Bildung (LfpB) Thüringen erschien. Seine Nachricht blieb bis zu seinem Tod unbeantwortet. Nun haben wir das Heft bestellt, gelesen und stellen es hiermit vor. von bjo:rn
von bjo:rn